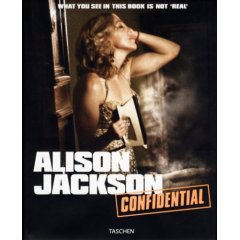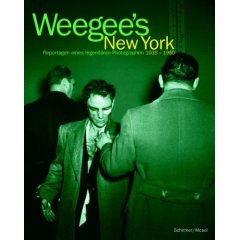NOTIZEN ZUM PAPARAZZO-GENRE
24. Juni 2008 | Von admin | Kategorie: Fotografie2008 © Fanny Melzer
Pa|pa|raz|zo, der; - …zzi (ital. Paparazzo) (scherzh.): italienische Bez. Für (aufdringlicher) Pressefotograf, Skandalreporter
Den Unterschied zwischen Wahrheit und Wirklichkeit festzustellen, ist in der Fotografie ein zum Scheitern verurteiltes Unfangen, selbst wenn MAGNUM-Gründer und Kriegsfotograf Robert Capa einst das Postulat verkündete: „Die Wahrheit ist das beste Bild.“
Wahrheit und Wirklichkeit schließen sich einander aus. Was als Wirklichkeit angesehen wird, ist Oberfläche, der subjektive Eindruck, allenfalls ein Gefühl, Blendwerk, Simulation, deren Inhalt kaum zu überprüfen ist. Meist lenkt die Wirklichkeit von der Wahrheit ab, denn nach der Wahrheit unter der Oberfläche der Verpackung zu fragen ist desillusionierend.
Aber wie will man Wirklichkeit zeigen, wenn nicht benannt ist, welche Form der Wirklichkeit gemeint ist? Das ist nicht nur eine rhetorische Frage, sondern berechtigter Verweis auf eine Mediendiskussion, die auf der Folie der Abbildtheorie bis heute ausgetragen wird. Denn es wird gerne außer Acht gelassen, dass Medien massiv an der Konstruktion von Wirklichkeit mitwirken oder, wie Günther Anders es treffend formuliert: „die Lüge sich wahrlügt, das Wirkliche zum Abbild seiner Bilder wird.“
Wirklichkeit und Inszenierung, die man in der Philosophie immer streng von einander getrennt hat, um schließlich über das Disputieren zu einer Wahrheit zu gelangen, um diese dann wieder auf den intellektuellen Prüfstand zu stellen, springen in der Medienwelt ineinander über wie ein Vexierbild, das die Begriffe kaum noch zu unterscheiden sind.
In diesem Verwirrspiel aus Wahrheit, Wirklichkeit, Inszenierung spielt die Fotografie eine besondere Rolle. Die Erzeugnisse des Leitmediums basieren auf bildnerischen Täuschungen, ganz gleich in welchem seriösen Zusammenhang sie daherkommen; sie zeigen nie das, was sie scheinen.
Beispiel: Zu unterscheiden, ob eine Fotografie der skandalumwitterten und im Schlampenlook daherkommende Amy Winehouse sie auch wirklich zeigt, ihre Knasttätowierungen tatsächlich in die Haut gestochen worden sind oder doch bloß Abziehbilder darstellen, wer kann darauf beim Betrachten einer Fotografie der Sängerin eine klare Antwort geben?
Die Regenbogenpresse gibt sich den moralischen Anstrich, das sie das kann: Sie vermittelt den Eindruck, dass sie unter Nutzung entsprechenden Bildmaterials und unter Verwendung von cremeweichen Subtexten das Wirkliche und Wahre, die Schattenseiten der Glamourwelt und den Preis des Ruhms verdichten kann.
Lieferanten dieser fotografischen Klatschwahrheiten sind die gesellschaftlichen Kriegsfotografen, die dem Beuteschema folgend der Boulevardprominenz auflauern. Ihr Motiv ist schlicht, banal. Es geht darum, der von den Massen angehimmelten Prominenz einen privaten Moment zu entreißen, sie in verfänglichen Situationen zu zeigen, die immer die gleiche die Botschaft haben: SIE sind wie WIR.
Die für diese simple Botschaft als Beweisfotos gedruckten Bilder erinnern von der Qualität an Fahndungsfotos, an die Plakate des Bundeskriminalamtes aus den Sechziger und Siebziger Jahren als die Mitglieder der Rote Armee Fraktion (RAF) bundesweit gesucht wurden. Die Unschärfe dieser Fotos, der Schwarz-Schweiß-Hochkontrast auf Billigpapier, die abgebildete Personen bedrohlich hässlich und charakterlos scheinen lässt, zielen auf den Reflex der Wiedererkennung, nähren Zweifel, bestätigen Vorurteile, legen die Vermutung nahe, dass eine gezeigte Person auf dem Fahndungsplakat möglicherweise in der direkten Nachbarschaft wohnen könnte. Mit diesem Appell an die niederen Instinkte ist der Denunziation Tür und Tor geöffnet. Solche Fotos haben zum Ziel, die Wahrnehmung von Betrachtern zu manipulieren, sie dorthin zu lenken, dass sie die Fotos tatsächlich für wahr annehmen.
Nach diesem Prinzip funktioniert die Paparazzo-Fotografie. Ein Trash-Genre, das im Hollywood der Fünfziger Jahre, in der Hochzeit der Skandalblätter wie Confindential, Whisper, Top Secret oder Hush-Hush zur Blüte kommt, um die hingebungsvollen Filmstarverehrer mit den neusten Nachrichten über Drogenkonsum und die sexuellen Neigungen der Hollywoodstars zu füttern. Garniert mit passenden Bildern im Stile von Verbrecherfotos, anrüchigen, diskreditierenden Nachtklub-Schnappschüssen, aufgenommen im drastischen Stil des Tatort-Fotografen Weegee.
Mit dieser Sichtweise auf die Prominenz verfolgen die Skandalblätter die Idee, den Unterschied zwischen fabrizierten Filmträumen und rauer Wirklichkeit in den harten Schlagschatten des Alltags zu zeigen und diese Idee schließlich als prophetische Wahrheiten über die Glamourwelt der Skandalblattleserschaft zu servieren. Die verwendete Bildästhetik ist unscharf, schemenhaft, grobkörnig. So kann die Leserschaft den eigenen Moralkodex in die Fotografie hineinphantasieren.
Nach dem vorläufigen Ende der Skandalblätter, das vor allem mit der sexuellen Revolution eingeläutet worden ist, kommt es zu einer Wiederbelebung der Blätter Ende der Siebziger Anfang der Achtziger Jahre. Es ist die Geburtsstunde der Regenbogenpresse, die sich im Gegensatz zu den Referenzblättern aus den Fünfzigern und in Ermangelung eines angemessenen, skandalisierenden Stoffs deutlich handzahmer generieren. Die Regenbogenpresse kocht einen eigenen bunten Informationsbrei aus Boulevardzutaten: Klatsch über Monarchen, wundersamen Heilungen, Diäten, Softsex, Romanzen von Pop-, TV- und Filmstars. Dabei handelt es sich um niederfrequente Unter-Haltung, ohne dabei zur Sache zu kommen.
In die Fotokunst hat das Trash-Genre in den Neunzigern Einzug genommen. Zu den ersten Künstlern gehört die Grazer Künstlergruppe G.R.A.M., die sich der Paparazzo-Stilistik bedienen, um die optischen Täuschungen, die mediale Simulation von Wirklichkeit und Wahrheit unter Verwendung inszenierter Fotografien aufzuzeigen. G.R.A.M. machte sich das Doppelgängermotiv zunutze, das Aussehen-Wie, um der Illusion des Bescheidwissens über Original und Fälschung, den Abgrund zwischen Glauben und Sehen, der Bruchstelle im schönen Schein eine Form zu geben.
Des gleichen Musters bedient sich die britische Künstlerin Alison Jackson, die in ihrer Publikation aus dem Jahr 2007 mit dem Titel Confidential ironisch an das gleichnamige US-Skandalblatt aus den Fünfzigern anknüpft, deren ruppige Doppelmoral der Filmregisseur Curtis Hanson in L.A. Confidential nach einer Romanvorlage von James Ellroy zehn Jahre vor Alison Jackson thematisiert.
Vor dieser Hintergrundskizze nennt Fanny Melzer ihre Diplomarbeit Paparazza, wobei weibliche Prominentenjäger, die dieser Begriff zum Ausdruck bringen soll, so gut wie gar nicht existieren. Paparazzi sind Männer: jung, dynamisch, clever, hartnäckig, unkompliziert, instinktgesteuert und bei der Durchsetzung ihrer Geschäftsinteressen skrupellos; so jedenfalls ist dieses Trash-Genre konnotiert.
Fanny Melzer bedient sich dieses Klischees. In ihren vermeintlich echten Fotografien richtet sie den Fokus auf den unspektakulären Alltag von „Prominenten“ und grenzt sich mit dieser Herangehensweise von Alison Jackson deutlich ab, die das Spektakel des Spektakels sucht. Diese eher ruhige Fotografie von Fanny Melzer birgt dennoch ein spannendes Vexierrätsel: Sind die fotografierten Personen auch tatsächlich die Personen, die wir glauben zu sehen?
FOTOGRAFISCHE QUELLEN:
- Alison Jackson, Confidential: 264 Seiten
- Verlag: Taschen Verlag; Auflage: 1 (10. September 2007)
- Sprache: Englisch, Deutsch, Französisch
- ISBN-10: 3822846384
- ISBN-13: 978-3822846384
- Weegee’s New York: Photografien 1935 - 1960
- Verlag: Schirmer/Mosel; Auflage: Sonderausgabe. (März 2006)
- Sprache: Deutsch
- ISBN-10: 3888148014
- ISBN-13: 978-3888148019
- Größe und/oder Gewicht: 28,9 x 23,6 x 3 cm
SPIELFILME:
LA DOLCE VITA VON FREDERICO FELLINI, 1952
L.A. CONFIDENTIAL VON CURTIS HANSON, 1997
LITERATUR:
ILLUSION UND SIMULATION, REIHE CANTZ, 1995
ICH WEIß BESCHEID, JAMES ELLROY, ULLSTEIN, 2005
WELTEN IM KOPF, BREUER/ LEUSCH / MERSCH,
WISSENSCHAFTLICHE BUCHGESELLSCHAFT, 1996